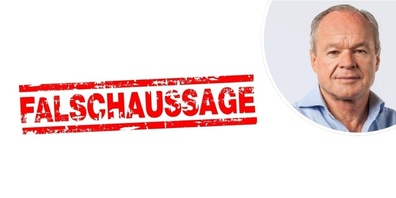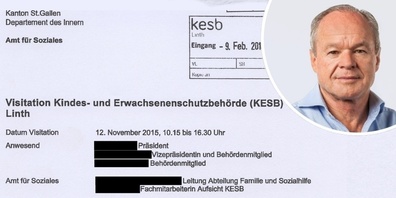Regulär hätte die Kesb-Klage am Kreisgericht Uznach SG verhandelt werden müssen. Der dortige Gerichtspräsident winkte jedoch ab. Vier seiner sieben Richter seien befangen, schrieb er. Sie stünden beruflich oder familiär mit der Kesb in Verbindung. Und zwischen seinem Gericht und der Kesb gebe es «institutionelle Beziehungen». Es stehe mit der Kesb zudem «in engem Kontakt» und veranstalte mit ihr «gemeinsame Ausflüge und gemeinsame Gerichtsessen».
Das wär dann ein Wink an all jene, die bezüglich Kesb vor einem Kreisgericht stehen (!).
Kesb-Betroffene ohne Stimme
Weil Uznach kneifen musste, wurde der Kesb-Prozess vom Kanton ans Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland verschoben. Aber auch hier dürften die Richter kaum Kesb-Gegner sein. Was sich später auch bestätigte: Es war selbst für die vom Verlag der Obersee Nachrichten (ON) engagierten Medienanwälte erschreckend, wie das Kreisgericht die Kesb in Schutz nahm. Teilweise übernahm es die Vorwürfe an die ON vom Kesb-Anwalt fast wörtlich.
Heraus kam ein Urteil, das das Handeln der Kesb nicht hinterfragte, sondern praktisch durchgehend schützte. Das Gericht nahm die Ausführungen der Kesb – wie später auch das Kantonsgericht – als gesetzte Tatsachen entgegen, ohne diese einer harten Prüfung zu unterwerfen. Bezeichnend war, dass die Gerichte keine einzige der von den Kesb-Massnahmen betroffenen Personen anhörte. Und das, obwohl sie alle angeboten haben, als Zeugen vor Gericht auszusagen.
Die Gerichte wussten wohl, warum sie die Betroffenen nicht vorluden. Denn dann hätte die Kesb nicht nur ihre eigene Sichtweise darstellen können.
Der Geruch von Befangenheit
Noch brisanter wurde es bei der 2. Berufungsinstanz, dem St. Galler Kantonsgericht. Es amtete nicht nur als Gericht in der Kesb-Klage, sondern es hatte auch schon über drei Kesb-Fälle gerichtet, die wir in den Obersee Nachrichten kritisiert hatten.
In all diesen drei Fällen liess das Kantonsgericht die Kesb-Betroffenen abblitzen. So beim bedenklichen Abstillbefehl der Kesb Linth an eine Mutter, im Fall Marco H. auf dem Jugendschiff und beim 8-jährigen Samuel, den die Kesb im Toggenburg fremdplatzierte.
Erstaunlich war auch: An allen diesen drei Urteilen gegen die Kesb-Betroffenen war Kantonsrichter Dr. Christian Schöbi beteiligt.
Nun war Dr. Schöbi aber auch Richter im Kesb-Prozess gegen die Obersee Nachrichten. Daraus folgt: Hätte das St. Galler Kantonsgericht in der Kesb-Klage die Berichte der Obersee Nachrichten geschützt, hätte es indirekt seine eigenen Urteile in den drei Kesb-Fällen in Frage gestellt.
Ein Schelm, wer hier dabei Böses denkt.
Grundlage war «Hirschmann II»
Die Obersee Nachrichten und wir Redaktoren wurden vom Stadtrat und dem Kesb-Leiter (auf Kosten der Steuerzahler) wegen «Persönlichkeitsverletzung aufgrund einer Medienkampagne» eingeklagt. Die Richter interessierten sich damit nicht für die Sorgen der Kesb-Betroffenen. Sie hatten primär das Ziel, dem ON-Verlag eine «Persönlichkeitsverletzung aufgrund einer Medienkampagne» zu unterstellen.
Der Begriff der «Persönlichkeitsverletzung aufgrund einer Medienkampagne» geht, wie in Folge 1 schon beschrieben, auf das umstrittene Bundesgerichtsurteil «Hirschmann II» zurück. Darin wurde der Tages-Anzeiger für schuldig befunden, mit Boulevard-Berichten den Zürcher Millionär Carl Hirschmann aufgrund vieler Zeitungsartikel in seiner Persönlichkeit verletzt zu haben. Nebenbei: An diesem Bundegerichtsurteil war Dr. Felix Schöbi beteiligt. Er ist der Bruder des St. Galler Kantonsrichters Dr. Christian Schöbi. Welche problematische Blüten dieses Bundesgerichts-Urteils nach sich zieht, und wie falsch die Gerichtsurteile der St. Galler Gerichte im Kesb-Prozess eingestuft werden, führe ich am Schluss dieses Berichts «St. Galler Gerichte interpretieren Hirschmann II falsch» aus.
Es ging um amtliches Handeln
Im Fall der ON-Berichte ging es nicht um Boulevard-Geschichten wie im Fall Hirschmann, sondern um staatliches Handeln. Und genau dazu wäre von den Gerichten eine fundierte Auseinandersetzung zu erwarten gewesen: Sind People-Berichte mit Staats-Kritik gleichzusetzen? Wer ist für Facebook-Posts verantwortlich, der Halter des Accounts oder die postende Person? Muss eine Zeitung Aussagen von Ärzten, Anwälten und Betroffenen zensurieren? Kann der Staat jetzt gegen Medien klagen, und wenn ja, kann die Presse über den Staat überhaupt noch kritisch berichten? Und was geschieht danach mit der Demokratie?
Das für solche Fragen zuständige Bundesgericht wich aus und nahm den Seitenausgang. Es schrieb, die Artikel der Obersee Nachrichten seien gelöscht worden. Damit sei die Frage obsolet, ob eine persönlichkeitsverletzende Kampagne vorgelegen habe. Das Bundesgericht befasste sich somit praktisch nicht mit der Grundthematik des Prozesses, sondern bestätigte in der Hauptsache lediglich die zehn Schreibverbote des Kantonsgerichts und gab den Fall zur Kosten-Regelung zurück nach St. Gallen.
Pressefreiheit: Abrutschen auf Rang 14
Damit bleibt die Rechtsauffassung aus dem Urteil des St. Galler Kantonsgerichts gültig, welches den Begriff der «Persönlichkeitsverletzung» von der privaten Boulevard-Ebene auf staatliches Handeln ausgeweitet hat. Man kann nun nur noch darauf warten, bis ein miserabel geführtes Amt oder überforderte Beamte und Politiker nach schlechter Arbeit und darauf gründender Medienkritik auf Staatskosten Klage gegen ein Medium erheben.
Ein Hinweis dazu findet sich in der aktuellen Beschwerde des Stadtrates von Rapperswil-Jona an den Schweizer Presserat. Der Stadtrat kritisiert darin zwei Kommentare von mir auf Linth24 zur Lido-Planung und zur Lakers-Trainingshalle. Den Presserat lässt der Stadtrat in seiner Eingabe in drohendem Ton wissen, er habe «bisher von (weiteren) Gerichts-Verfahren» gegen Linth24 abgesehen. (Zum Bericht: www.linth24.ch)
Um die Pressefreiheit steht es in der Schweiz nicht gut. Innerhalb des letzten Jahres ist sie weltweit vom 10. auf den 14. Platz abgerutscht. Mit dem Urteil des St. Galler Kantonsgerichts droht ihr ein weiterer Niedergang.