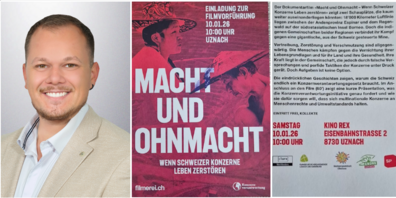Immer wieder erschüttern brutale Gewalttaten die Gesellschaft, wie zuletzt der Machetenangriff in St. Gallen, bei dem fünf Menschen verletzt wurden. Solche willkürlichen Angriffe werfen die Frage auf: Was treibt Menschen dazu, unschuldige Opfer zu attackieren? Und wie können solche Taten verhindert werden?
Karl Weilbach, Kriminologe und forensischer Prognostiker, beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit den Ursachen von Gewalt und der Prävention von Kriminalität. Als Leiter des CAS Krisenintervention an der Ostschweizer Fachhochschule ist er ein Experte auf diesem Gebiet und erläutert im Gespräch, wie sich tief verwurzelte Frustration und Wut in zerstörerische Gewalt verwandeln können.
Das verzerrte Weltbild der Täter
Weilbach erklärt, dass die meisten schweren Gewalttaten einem tiefen Kränkungserlebnis vorausgehen. Häufig sind die Täter von einem Gefühl der Demütigung oder des Versagens getrieben. Sie machen andere für die Missstände in ihrem Leben verantwortlich und projizieren ihre eigenen Ängste und Unsicherheiten auf ahnungslose Opfer, die für Täter Sündenböcke darstellen.
Dieser tief verwurzelte Hass auf die Gesellschaft kann sich in der Gewaltentladung manifestieren. In solchen Momenten sind die Täter überzeugt, dass ihre Gewalttat gerechtfertigt ist, dass sie sich im Recht befinden. Dabei geht es ihnen nicht um Rache, sondern eher um das Bedürfnis die Kontrolle zurückzugewinnen.
Der Verlust der Tötungshemmung
Doch was passiert im Inneren eines Menschen, bevor er zur Tat schreitet? Nach Weilbachs Forschung gibt es drei entscheidende Entwicklungsstadien, die zu einer solchen Eskalation führen können: Interpretation, Transformation und Handlung. Zunächst interpretieren die Täter ihre sozialen Erfahrungen und Umwelt hochgradig subjektiv. Sie fühlen sich von anderen gekränkt und glauben, ihre Identität und Werte verteidigen zu müssen. Daraus entsteht eine Wut, die irgendwann in einen gewaltsamen Akt umschlägt. Es ist dieser Prozess, der die natürliche Hemmung zur Gewalt auflöst und den Täter dazu bringt, grausame Taten zu begehen.
Frühwarnzeichen für Gewalt
Psychische Erkrankungen begünstigen nicht zwangsläufig Gewalt, können sie aber verstärken. Ein Beispiel ist der Angriff eines schizophrenen Mannes auf ein Mädchen im April 2024.
Ein weiteres Thema sind Drohungen, die oft vor Gewalttaten stehen. Drohungen müssen ernst genommen und richtig eingeschätzt werden. Potenzielle Täter haben häufig eine gewalttätige Vorgeschichte, was präventive Massnahmen erschwert.
Gemeinsam gegen Gewalt
«Warum greifen die Behörden nicht früher ein, wenn der Täter bereits bekannt ist?», eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Weilbach erklärt, dass der Rechtsstaat und die Strafverfolgungsbehörden nicht unbegrenzt überwachen dürfe, da jeder Mensch ein Recht auf Veränderung hat. Es ist ein Dilemma: Ohne konkrete Hinweise auf eine bevorstehende Straftat können keine präventiven Massnahmen ergriffen werden. Und hier ist die Gesellschaft gefragt: Sie muss frühzeitig aufmerksam werden, und aktiv handeln, denn der Schlüssel zur Prävention liegt in der sozialen Verantwortung.